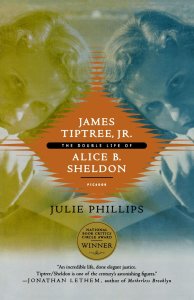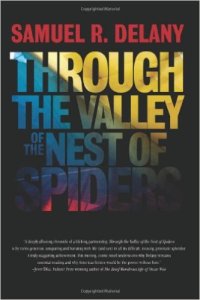Michael K. Iwoleit hat schon zahlreiche SF-Preise und Nominierungen erhalten. Als Mitherausgeber von Nova trägt er dazu bei, dass die Storyszene in Deutschland lebendig bleibt. Außerdem schreibt er immer wieder Essays und Artikel zur SF-Literatur. Lesen Sie nun exklusiv bei uns seine Meinung zur literarischen Einordnung aktueller SF, die er bereits in TERRAsse (Begleitheft zum Pentacon 2015) kundgetan hat:
Michael K. Iwoleit –
Die neue Annäherung von Science Fiction und Literatur
1988 schrieb der kürzlich verstorbene Wolfgang Jeschke im Editorial des Almanachs Das Science Fiction Jahr: “Mir passiert es immer wieder , etwa wenn man Anthologien wie Der verkabelte Mensch, hrsg. von Gerd E. Hoffmann, oder Die siebente Reise, hrsg. von Roman Ritter und Herman Peter Piwitt, aufschlägt und auf Texte von bekannten Autoren stößt, die man sonst durchaus für gute, zumindest passable Autoren hält, daß sich einem ein Aufseufzen entringt und man sich insgeheim wünscht: Hätte er doch wenigstens ein bißchen SF gelesen! Und: Hat das nicht Nelson Bond oder R.A. Lafferty oder Fredric Brown oder wer sonst auch immer vor dreißig, vierzig Jahren nicht viel pfiffiger, nicht viel einfallsreicher gebracht? (…) Legt man SF-Maßstäbe an Texte an, die von Autoren der sog. Mainstream-Literatur geschrieben wurden, dann verbreiten sie meist gähnende Langeweile, wenn sie einem unter dem Label ‘Phantastik’ unterkommen.”1 Diese Fronthaltung zwischen Science Fiction (und Genre-Literatur überhaupt) auf der einen und sogenannter “ernsthafter” Literatur auf der anderen Seite war noch bis in die Neunzigerjahre hinein eine offenkundige Tatsache. Zum einen bezeugten Mainstream-Autoren, wenn sie sich an SF-artige Stoffe heranwagten, eine bestürzende Naivität gegenüber dem, was in der Genre-SF bereits alles passiert war, oder kamen über das leicht verstaubte Motivinventar der traditionellen Utopie und Dystopie nicht nennenswert hinaus. Zum anderen wollten Kulturmedien außerhalb der SF-Szene lange Zeit nicht wahrhaben, daß es, von Stanislaw Lem abgesehen, überhaupt SF-Autoren mit einer über das Genre hinausgehenden Bedeutung gibt. Der unaufhaltsame Aufstieg von Philip K. Dick zu einem der Monumente der amerikanischen Nachkriegsliteratur, ironischerweise durch Hollywood-Verfilmungen angebahnt, sollte erst über zwanzig Jahre nach seinem Tod in den Köpfen der literarisch Interessierten ankommen. Erst nach dem Bestseller-Erfolg seines von Spielberg verfilmten Romans Empire of the Sun (1984) wandelte sich das Image eines J.G. Ballard langsam von dem einer Obskurität in SF- und Avantgarde-Magazinen zu einem der führenden britischen Schriftsteller seiner Generation. Die Auseinandersetzung mit SF-Autoren, sofern sie überhaupt einmal zu allgemeinliterarischen Veranstaltungen eingeladen wurden, beschränkte sich weitgehend auf Grundsatzdebatten und Rechtfertigungen (als SF-Schaffender, der seit der Mitte der Achtzigerjahre dabei ist und an vielen Veranstaltungen dieser Art teilgenommen hat, kann ich aus Erfahrung sprechen). Eine thematische und literarische Aufarbeitung der Science Fiction leisteten außerhalb der Szene weder Literaturkrik noch Literaturwissenschaft. Die vorherrschende Perspektive war dünkelhafte Ahnungslosigkeit. Akademische Monographien zur Science Fiction wurden vornehmlich von Leuten geschrieben, die – um eine heute populäre Phrase zu mißbrauchen – ihre Hausaufgaben mehr als nicht gemacht hatten.
Die Situation hat sich in vielerlei Hinsicht dramatisch verändert. Von der SF-Szene bemerkenswert wenig beachtet, kommentiert oder gar begrüßt, ist etwas eingetreten, wovon ambitionierte SF-Macher in den Achtzigern nur träumen konnten: die SF – als literarische Taktik, als ein Komplex von Themen, Motiven und Techniken – ist in der allgemeinen Literatur angekommen. Zum einen erscheinen immer mehr Bücher, die zwar auf das Label Science Fiction verzichten, aber deutliche Anleihen bei der Science Fiction machen oder, genau besehen, lupenreine Science Fiction sind und deren Verfasser, obwohl fest in der Mainstream-Literatur etabliert, nicht bloß ein paar SF-Ideen aufgeschnappt, sondern die Science Fiction – und mit ihr andere Segmente der Populärkultur – erkennbar rezipiert und intelligent verarbeitet haben. Heute kann ein Mainstream-Autor wie der russischstämmige Amerikaner Gary Shteyngart mit seinem ebenso witzigen wie einfallsreichen Roman Super Sad True Love Story (2010), der soziale Netzwerke und die Preisgabe des Privaten in die nahe Zukunft weiterdenkt, einem Großteil der zeitgenössischen SF-Genreautoren eine Lektion erteilen, wie man’s macht. Ein renommierter Mann wie der Engländer David Mitchell kombiniert und verschränkt, souverän und unverkrampft, Genre-Versatzstücke vom historischen über den Abenteuerroman bis hin zur Science Fiction. Die besten Romane eines Richard Powers, denen gelungen ist, was der Cyberpunk nur versucht hat – den Jargon der technisch-naturwissenschaftlichen Intelligentsia literarisch abzubilden -, sind kaum denkbar ohne die Aufgeschlossenheit für Ideen und Gedankenexperimente, die die SF in die Gegenwartsliteratur eingebracht hat. Es ist ein neuartiger Typus von Schriftsteller entstanden, dem der Brückenschlag zwischen den einst verfeindeten Lagern der literarisch-musischen und der naturwissenschaftlich-technischen Kultur dadurch gelungen ist, daß sie die reichen Techniken der modernen und postmodernen Literatur beherrschen und zugleich in der Gedankenwelt des anderen Lagers zuhause sind, und für das Auftreten dieses Typus dürften SF-Autoren Pate gestanden haben. (Der wichtigste Schrifsteller dieser Art im deutschen Sprachraum ist Dietmar Dath, und interessanterweise hat sein unverkrampfter Umgang mit der SF dazu geführt, daß Suhrkamp seinen Roman Feldeváye [2014] auf dem Cover wieder unverblümt als Science Fiction bezeichnet hat.)
Zum anderen sind Autoren, auf die SF-Insider viele Jahre vergeblich aufmerksam zu machen versuchten, inzwischen auf langen und überraschenden Umwegen in den Rang kultureller Ideenstifter aufgestiegen (um eine Formulierung zu verwenden, die Horst Pukallus im Zusammenhang mit William S. Burroughs gebraucht hat). Ein knappes Vierteljahrhundert nach seinem Tod ist der immense Einfluß, den Philip K. Dick auf Autoren, Musiker, Künstler und Regisseure weit über die SF hinaus ausgeübt hat, kaum mehr zu überschauen. Aufgrund von Mainstream-Romanen aus den Fünfzigerjahren, die er zu Lebzeiten nicht veröffentlichen konnte, wird er inzwischen sogar von der traditionell flügellahmen deutschen Literaturkritik mit anerkannten literarischen Größen wie seinem Landsmann Richard Yates verglichen. Als J.G. Ballard 2009 an einer Krebserkrankung starb, quollen die deutschen Publikumsmedien geradezu über von überraschend treffenden und kenntnisreichen Nachrufen, und in Feuilletons, die in den Achzigerjahren kein Sterbenswörtchen über ihn gebracht hätten, wurde ihm in einem Ton gehuldigt, als habe man ihn schon immer gekannt und geschätzt. Wenn die aufsehenerregende Biographie James Tiptree, jr. The Double Life of Alice B. Sheldon von Julie Philips und das Interesse, das die deutschsprachige Tiptree-Gesamtausgabe auf der letzten Frankfurter Buchmesse erregt hat, als Indizien gelten können, so könnte Alice Sheldon alias James Tiptree, jr., eine der größten Kurzgeschichtenautoren überhaupt, als nächste der überfällige posthume Ruhm zuteil werden. Bedeutenden SF- und Phantastik-Autoren von kaum geringerem Rang, etwa Gene Wolfe oder der 2014 verstorbene Lucius Shepard, ist die verdiente Anerkennung bislang versagt geblieben, aber es ist nicht mehr ausgeschlossen, daß auch sie in den allgemeinen Literaturkanon aufrücken werden. Immer mehr talentierte Autoren, die in der SF angefangen haben, brauchen gar nicht mehr auf posthumen Ruhm zu warten. William Gibson hatte es noch den besonderen Zeitumständen zu verdanken, daß er vom SF-Autor zu einer Ikone des Internet- Zeitalters geworden ist. Andere haben davon profitiert, daß sich die SF, die früher als ein ausgesprochen angloamerikanisches Phänomen wahrgenommen wurde, zu einer globalen und multikulturellen Ausdrucksform ausgeweitet hat. Vor zwanzig Jahren praktisch undenkbar, hat die französisch-amerikanische Autorin Aliette de Bodard als erste kontinentaleuropäische Autorin den Nebula Award, die höchste Auszeichnung der SF-Szene, mehrfach gewonnen. In Gardner Dozois jährlichen Auswahlanthologien tauchen nun regelmäßig “Exoten” wie der Israeli Lavie Tidhar oder die indisch-amerikanische Autoren Vandana Singh auf. Autoren wie der Amerikaner Jonathan Lethem, die Spanierin Elia Barceló oder die Finnen Johanna Sinisalo und Pasi Ilmari Jääskeläinen, mit Wurzeln in der SF-Szene und sogar im SF-Fandom, feiern auf dem allgemeinen Buchmarkt internationale Erfolge und werden kaum noch als SF-Autoren wahrgenommen. Von der eingefleischten SF-Leserschaft praktisch unbemerkt, ist SF-Veteran Samuel R. Delany zu einem der großen Geheimtips der amerikanischen Gegenwartsliteratur aufgestiegen, und nicht wenige Literaturkenner sind davon überzeugt, daß künftige Generationen seinen Roman Through the Valley of the Nest of Spiders (2012) als einen der besten englischsprachigen Romane des neuen Jahrhunderts einstufen werden.
Ist also alles in Ordnung? Sind Science Fiction und Literatur miteinander versöhnt? Können SF-Autoren sich entspannt zurücklehnen und darauf hoffen, künftig unvoreingenommen beurteilt zu werden? Eher nicht. Eine Kehrseite der ganzen Entwicklung ist, daß das Image der SF als Genre so schlecht ist wie nie, daß das Label “Science Fiction” vor allem mit trivialen, kommerziellen Erzeugnissen im Bereich Film und Computerspiel assoziiert wird und auf viele Buchkäufer abschreckend wirkt. Franz Rottensteiner hat zu Recht angemerkt, daß das Etikett “Science Fiction” für einen Autor geschäftsschädigend geworden ist. Wer heute ambitionierte Science Fiction schreiben will, tut gut daran, auf das Label ganz zu verzichten. Hinzu kommt, daß das Sektierertum der SF-Szene eher zu- als abgenommen hat. Die Szene nimmt bemerkenswert wenig Anteil am Aufgehen der SF in die Mainstream-Literatur und -Kultur. Für einen Artikel, der im diesjährigen Science Fiction Jahr (ab 2015 bei Golkonda) erscheinen wird, habe ich es auf mich genommen, einen Großteil der deutschsprachigen SF-Kurzgeschichten-Produktion des Jahres 2014 zu lesen, und das Ergebnis bestätigt den Eindruck, den ich als Mitherausgeber und Story-Redakteur der Magazins Nova gewonnen habe. Zwar können wir damit zufrieden sein, daß eine kleine, geschrumpfte und kommerziell unbedeutende Szene wie unsere immer noch fünf bis fünfzehn Autoren vorweisen kann, die lesenswertes bis literarisch ansprechendes Material produzieren können. Andererseits werden immer noch viel zu viele Autoren publiziert, die meinen, daß es für einen SF-Autor ausreicht, sich nur für SF zu interessieren und nur SF zu lesen. Immer noch sind viele SF-Macher außerstande, Ideen und Anregungen von außerhalb der SF-Szene aufzunehmen, an Kultur und Literatur im weiteren Sinne teilzuhaben. Immer noch ahmen zu viele Neulinge die Untugenden schlechter amerikanischer Vorbilder so besinnungslos nach, als ob die gesamte dezidierte SF-Kritik der Sechziger- bis Achtzigerjahre, die Auseinandersetzung mit Klischees und Versatzstücken in zahlreichen Jahrgängen der Science Fiction Times oder des Science Fiction Jahrs völlig an ihnen vorbeigegangen ist. Die SF-Szene läuft Gefahr, auf lange Sicht genau dort zu landen, wo in den Achtzigerjahren das literarische Establishment gestanden hat: in der Ecke der langweiligen, rückständigen Spießer.
Was ist zu tun? Eine einfache Antwort kann auch ich nicht geben, aber vielleicht einen Leitgedanken, der auf dem 9. Penta-Con in Dresden diskutiert werden kann: Niemand muß sich dafür schämen, daß er ein SF-Autor ist. Niemand muß sich mit den Klischees identifizieren, die mit dem Label Science Fiction gemeinhin assoziiert werden. Aber im gewandelten kulturellen Kontext, in dem wir heute SF produzieren, müssen wir uns fragen: Was ist uns wichtiger, das Etikett “Science Fiction” oder das, was SF eigentlich ausmacht, nämlich die Erzähltechniken und Themen, die wir bevorzugt anwenden und die nicht ohne Grund immer mehr von der allgemeinen Literatur adaptiert werden? Was ist wichtiger: ob auf einem Buchcover “Science Fiction” steht oder ob ein Buch Anerkennung für die geschickte und originelle Anwendung eben dieser Themen und Techniken findet? Muß eine SF-Veranstaltung unbedingt als eine solche auftreten? Haben die Entwicklungen in der Mainstream-Literatur nicht bewiesen, daß es ein potentielles SF-Publikum gibt, das wir durch unser hartnäckiges Festhalten am Label SF (und, dafür vielleicht symptomatisch, durch ein Beharren auf einem Auserwähltheitsgefühl der SF-Szene) abschrecken?
Dies sind die Fragen, die mich immer mehr beschäftigen.
1 Wolfgang Jeschke (Hrsg.): Das Science Fiction Jahr. Ausgabe 1988, Wilhelm Heyne Verlag, München 1988, S.16.
Copyright © 2015 by Michael Iwoleit