Nach einer globalen Katastrophe – Atomkrieg, Seuchen, Klimawandel – haben die überlebenden Menschen die Macht über die Welt an eine gewaltige KI namens Askit abgegeben, die daraufhin über mehrere Generationen hinweg die Reste der alten Zivilisation recycelt und den Menschen in einigen großen, geschützten Refugien Sicherheit und Überleben bietet. Die Elite bilden die “Reinsten”, die dank Cyber-Implantat ständig mit Askit verbunden sind, gescannt und mit Punktzahlen bewertet werden. Die “Reinsten” sind Wissenschaftler, die gemeinsam mit Askit an der Wiederherstellung der Welt arbeiten. Allerdings beantwortet Askit, anders als sein Name suggeriert, keineswegs alle Fragen der Menschen, sondern scheint einen eigenen, undurchschaubaren Plan zu verfolgen. Als eine der Reinsten, Eve, aus “Paradise” (!) und damit dem Einflussbereich von Askit flieht, trifft sie weit weg auf von Askit geduldete Kolonisten, die der postapokalyptischen Welt auf ihre eigene Weise Lebensraum abgerungen haben. Dort werden nach und nach Geheimnisse der Vergangenheit gelüftet, aus denen sich dramatische Zukunftsfragen ergeben.

Der soweit durchaus reizvolle Ansatz hat in der Romanumsetzung leider gleich mehrere Probleme. Das größte davon ist Askit. Die undurchschaubare KI ist nichts anderes als ein gigantischer deus ex machina. Zu keinem Zeitpunkt haben die menschlichen Figuren irgendeine Chance, die genauen Pläne von Askit zu erkennen, Gründe für seine Handlungen nachzuvollziehen oder gar Einfluss auf es (Askit ist sächlichen Geschlechts) zu nehmen. Die “Reinsten”, die an sich Wissenschaftler sein sollen, handeln zumindest nach heutigen Maßstäben nicht wie solche. Sie reden viel und viel aneinander vorbei, sie reisen umher, debattieren über vage Vermutungen, ohne Tiefgang, ohne Erkenntnisgewinn. Erst nach einem Drittel des Romans kommt die Handlung richtig in Gang. Den zu diesem Zeitpunkt “Verstoßenen” (laut Klappentext; in Wirklichkeit läuft Eve aus eigenem Antrieb vor Askit weg) bleibt nichts anderes übrig, als wild über Askits Entstehung, Aufbau und Absichten zu spekulieren. Dabei wird auf plausible Argumentationsketten weitgehend verzichtet, stattdessen wird “vertrau mir bitte” gesagt oder ein ernsthaftes Gesicht aufgesetzt. Wilde Vermutungen werden teils mehrfach wiederholt, überprüfen kann sie niemand, da sich Askit jeglicher Frage nach Belieben entziehen kann (oder sie mit wenig hilfreichem Geschwurbel beantwortet) und anscheinend auch alle Wissensdatenbanken der Welt kontrolliert. Keiner der Wissenschaftler kommt auf die Idee, mal nach Beweisen für seine Vermutungen zu suchen, oder andere Figuren, die irgendwelche Behauptungen aufstellen, nach stichhaltigen Beweisen für ihre Thesen zu fragen. Als dann die zunehmend weinerliche, in Extremsituationen auch mal in Ohnmacht fallende Protagonistin (die eigentlich durch Genmanipulation emotional optimiert sein soll) auch noch anfängt, einen stattlichen, kernigen Kolonisten anzuschmachten, ist der Rezensent geneigt, das Buch in die Ecke zu pfeffern. Zum Glück vermeidet es der Roman so gerade noch, in eine banale Liebesgeschichte abzugleiten.
Auffällig ist, dass die Figuren sehr viel nonverbal kommunizieren, während sie kaum einen längeren Gedankengang nachvollziehbar in Worte fassen können, ohne mittendrin das Thema zu wechseln. Ersatzweise werden Fäuste geballt, tief geseufzt, besorgt gefragt, die Augen aufgerissen, oder Figuren richten sich nach dem vagen Gefühl, ihr Gegenüber verfolge irgendeinen Plan (den sie selbst definitiv nicht haben). Da der größte Teil des Textes aus Dialogen (verbal und nonverbal) besteht, ist es bisweilen schwierig, Beweggründe der Figuren nachzuvollziehen, sich mit ihnen zu identifizieren. Das alles untergräbt nachhaltig die Glaubwürdigkeit der ganzen Weltkonstruktion.
Keinesfalls geht das Buch als Wissenschaftsthriller durch. Für einen Thriller ist es schlicht nicht spannend genug, und wissenschaftlich bleibt es arg oberflächlich. Wenn von Quantencomputern, Viren, Kryptologie oder Hydroponik die Rede ist, dann klingt das eher nach ein paar aus einschlägigen Artikeln zusammengeklaubten Begriffen als nach einem konsistenten, durchdachten Weltentwurf. Als solcher taugt das Buch einfach nicht: Wir bewegen uns fast nur in wenigen recht abgeschlossenen Milieus und erfahren wenig bis nichts über das Sozial- oder Wirtschaftssystem, über Leben oder Schicksal von Durchschnittsmenschen, über Medien oder Kultur, über Farben, Gebräuche, Gerüche, Kleidung, Ernährung. Die restliche Bevölkerung wird wenn überhaupt als diffuse Menschenansammlung beschrieben, die der einen oder anderen Ansprache lauscht. Das vermag kein besonders großes Leseinteresse auszulösen.
Mehr noch: Das Buch enthält so viele Fehler (Tippfehler, falsche Präpositionen, Bezugsfehler, Wortwiederholungen), dass man zwischendurch irritiert nachschaut, ob wirklich “Golkonda” auf dem Cover steht, und man nicht irgendein unterdurchschnittliches Selfpublisher-Werk vor sich hat.
Fraglos sind Klimawandel und ethische Fragen nach Verursachern und geeigneten Auswegen von großer Bedeutung für die SF. Aber diese auf eine so wirre, abgehobene, humorlose Art zu verhandeln wie in diesem Roman, ist wohl kaum der optimale Ansatz.
Unterhaltung: ![]()
Anspruch: ![]()
![]()
![]()
Originalität: ![]()
![]()




 Marc-Uwe Kling gewann mit dem Roman “Qualityland” dieses Jahr den Deutschen Science Fiction Preis. Grund genug, sich das neueste Werk des Autors anzuschauen, auch wenn die Anekdoten aus seiner Känguru-WG nicht ins SF-Genre fallen, es sei denn, man unterstellt, dass das Känguru ein außerirdischer Besucher ist. Ganz unlogisch ist das nicht, oder gibt es auf der Erde etwa sprechende, kommunistische Kängurus? Eben.
Marc-Uwe Kling gewann mit dem Roman “Qualityland” dieses Jahr den Deutschen Science Fiction Preis. Grund genug, sich das neueste Werk des Autors anzuschauen, auch wenn die Anekdoten aus seiner Känguru-WG nicht ins SF-Genre fallen, es sei denn, man unterstellt, dass das Känguru ein außerirdischer Besucher ist. Ganz unlogisch ist das nicht, oder gibt es auf der Erde etwa sprechende, kommunistische Kängurus? Eben. Mit dem zweiten Band der “neuen” Shadowrun-Romanserie legt Pegasus Press ein weiteres Newcomer-Werk vor. Zumindest ist Jan-Tobias Kitzel abgesehen von Kurzgeschichten und Romanen in Szeneverlagen noch nicht groß in Erscheinung getreten. Das, soviel sei vorweg gesagt, tut der Sache aber keinen Abbruch.
Mit dem zweiten Band der “neuen” Shadowrun-Romanserie legt Pegasus Press ein weiteres Newcomer-Werk vor. Zumindest ist Jan-Tobias Kitzel abgesehen von Kurzgeschichten und Romanen in Szeneverlagen noch nicht groß in Erscheinung getreten. Das, soviel sei vorweg gesagt, tut der Sache aber keinen Abbruch.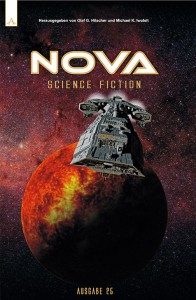 Seit kurzem ist endlich die 25. Ausgabe von NOVA erhältlich. Auf die Verzögerungen soll hier nicht weiter eingegangen werden, aber da sich das Personalkarussel bei den Herausgebern nunmehr weiter dreht und künftig ein anderer Verlag das Magazin herausbringt, kann man auf Besserung hoffen.
Seit kurzem ist endlich die 25. Ausgabe von NOVA erhältlich. Auf die Verzögerungen soll hier nicht weiter eingegangen werden, aber da sich das Personalkarussel bei den Herausgebern nunmehr weiter dreht und künftig ein anderer Verlag das Magazin herausbringt, kann man auf Besserung hoffen. Der Pegasus-Spieleverlag versucht sich am Neustart einer Shadowrun-Rollenspiel-Romanserie – geschrieben von deutschen Autoren. Den Anfang macht mit David Grade ein bisher in der SF-Szene eher unbeschriebenes Blatt – daher sind wir auf das Ergebnis ganz besonders gespannt.
Der Pegasus-Spieleverlag versucht sich am Neustart einer Shadowrun-Rollenspiel-Romanserie – geschrieben von deutschen Autoren. Den Anfang macht mit David Grade ein bisher in der SF-Szene eher unbeschriebenes Blatt – daher sind wir auf das Ergebnis ganz besonders gespannt.